Kunst oder Quatsch? So war der neue Luzerner "Tatort"
5.8.2018, 21:45 Uhr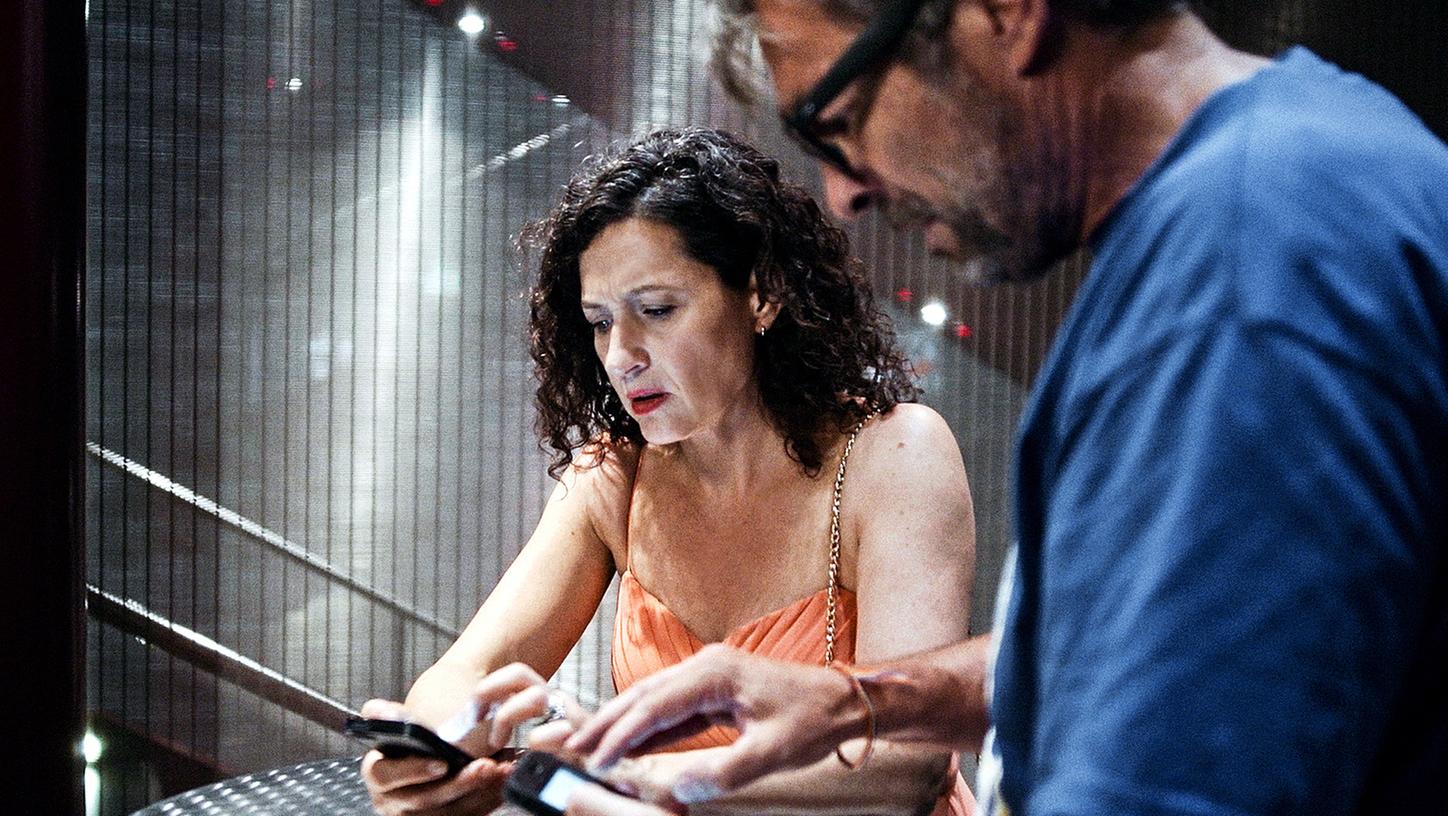
Mit der Ausstrahlung von Dani Levys Produktion endet die "Tatort" Sommerpause. Lediglich Til Schweigers Kino-"Tatort" flimmerte während dieser Zeit als TV-Premiere über den Sender, was dem Schauspieler ganz und gar nicht schmeckte. Denn so holte Tschillers Rachefeldzug durch halb Europa lediglich fünf Millionen Zuschauer hinter dem Ofen hervor. Verglichen mit den Ergebnissen anderer Folgen ein ziemliches Desaster.
Apropos Desaster: Mit durchwachsenen Einschaltquoten haben die Luzerner Ermittler ebenfalls zu kämpfen. Der 2011 ins Leben gerufene Ableger stieß in all den Jahren nie so wirklich auf große Zuschauerliebe. Daher zog der SRF jetzt die Reißleine und verkündete, die Fahnder Ende des kommenden Jahres in Rente zu schicken. Bis dahin sollen neben "Die Musik stirbt zuletzt" noch zwei weitere Filme zu sehen sein. Danach ist ein Neustart mit frischem Ensemble in Zürich geplant.
Erster "Tatort" als One-Take-Shot
Doch zurück zur Gegenwart und Flückigers (Stefan Gubser) und Ritschards (Delia Meyer) drittletztem Einsatz, der dank seiner Inszenierung wirklich ein herausragendes Stück Filmkunst darstellt. Dani Levy präsentiert einen One-Take-Shot und damit den allerersten Fernsehkrimi dieser Art. Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist das Luzerner Kultur- und Kongresszentrum (KKL), wo Walter Loving (Hans Hollmann) - schwerreicher Unternehmer und Mäzen - ein Benefizkonzert mit dem Jewish Chamber Orchestra veranstaltet. Das Ensemble spielt Stücke von Komponisten, die während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslagern zu Tode kamen.
Loving hat in seiner Jugend vielen jüdischen Flüchtlingen über die Landesgrenze geholfen und damit ihr Überleben gesichert. Doch es mehren sich Zweifel an des Patriarchen weißer Weste. Deshalb plant die mit Beweisen ausgestattete und dem Orchester zugehörige Pianistin Miriam Goldstein (Teresa Harder), während des Konzerts ein dunkles Familiengeheimnis zu lüften und damit Lovings doppelte Identität preiszugeben. Als kurz nach Beginn der Veranstaltung Goldsteins Bruder, der Klarinettist Vincent (Patrick Elias), und wenig später Lovings Chef-Juristin (Uygar Tamer) vergiftet zusammenbrechen, ruft das die beiden Kommissare auf den Plan.
Fiktive Geschichte mit wahrem Kern
Dany Levy "Tatort" ist eine rein fiktive Geschichte. Doch tief in ihr drin schlummert ein wahrer Kern. Mit dem Ziel, ein bislang unbekanntes Stück Schweizer Vergangenheit in die Handlung zu integrieren, sind der Regisseur und sein Team auf den Bergier-Bericht gestoßen, der die Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs detailliert untersucht. Ein Kapitel thematisiert die Rolle der Schweizer Intermediäre. Dabei handelt es sich um Mittler zwischen Deutschen und Juden in Freikaufs- und Lösegeldangelegenheiten. Also um Schlepper und Fluchthelfer.
Allein dieser Kniff im Drehbuch macht den Film sehenswert. Als Kirsche auf Dani Levys Torte fungiert jedoch die spezielle Drehtechnik. Die Idee, einen One-Take-Shot zu produzieren, fällt dem Regisseur dabei mehr oder weniger in den Schoß. Weil ihm der Hauptdrehort nur wenige Tage zur Verfügung steht, erinnert sich Levy an Sebastian Schippers "Victoria". Dessen Arbeit kommt ohne einen einzigen Schnitt aus und stellt für Levy die "entfesselndste und radikalste Form eines One-Shots dar".
Große Herausforderung für die Beteiligten
Davon inspiriert fassen Regisseur und Team schließlich den Beschluss, ihren "Tatort" ebenfalls in nur einer einzigen Einstellung zu drehen. Im Gegensatz zu "Victoria" wird Levys Krimi aber nicht aus der Sicht einer Hauptfigur erzählt, sondern perspektivisch. Die Kamera reist sozusagen von einem Handlungspunkt zum nächsten.
Dadurch entstehen irre Fahrten quer durch die Orchesterreihen, an den Zuschauern entlang, hinaus aus dem KKL und wieder hinein. Sogar eine Rückblende kommt vor und ist toll in das Konzept integriert. Das hat natürlich zur Folge, dass alle Beteiligten auf die Sekunde funktionieren und hellwach sein müssen. Eine immense Herausforderung für Schauspieler, Tontechniker sowie Kameraleute.
Aber ebenso für den Zuschauer. Denn der benötigt etwas Zeit, sich an diese fliegende Kamera zu gewöhnen. Wegen der fehlenden Schnitte und eines in Erscheinung tretenden Erzählers, der in die Kamera spricht und dem Treiben theaterhafte Züge verleiht, irritiert Dani Levys "Tatort" vor allem zu Beginn sehr. Doch wer sich auf das Projekt einlässt, erhält ein bemerkenswertes Stück TV-Kunst aufgetischt, in dem ein Rädchen ins nächste greift. Da seien auch die wenigen Schwächen verziehen, wie es sie bei Massenszenen gibt, in denen die Akteure auffallend unsicher agieren. Sie ändern nichts am guten Gesamteindruck. Und der zählt ja bekanntlich.
2 Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.
0/1000 Zeichen


