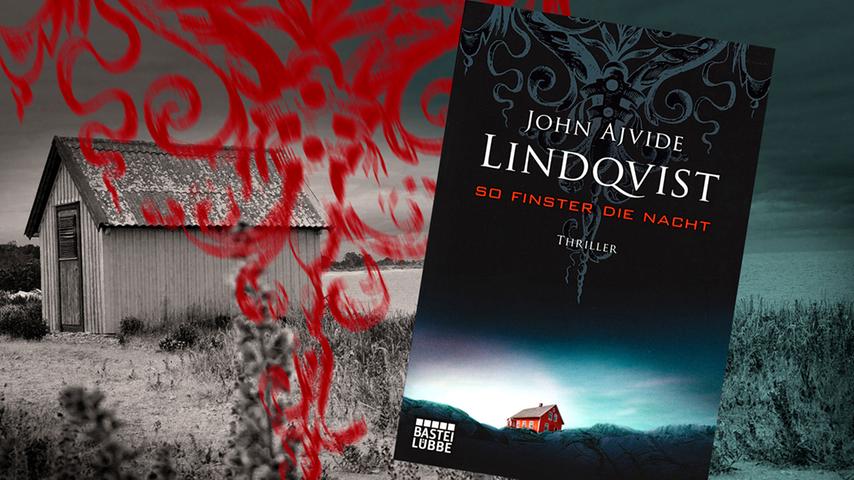Sebastian Fitzek: "Tod riecht nach süßer, ranziger Leberwurst"
4.11.2014, 08:02 Uhr
Herr Fitzek, wenn es am 31. Oktober an Ihrer Haustür klingelt, was gibt es dann? Süßes oder Saures?
Fitzek: Ein Sammelsurium aus eingepackten und eingeschweißten Süßigkeiten. In den USA gab es ja immer wieder mal Skandale - leider. Weil auch diese Tradition dazu missbraucht wurde, dass da Leute ihr Unwesen getrieben und Kinder vergiftet haben. Das kommt bei uns natürlich nicht vor, aber Eltern sind da sensibilisiert. Deswegen gibt es eingepackte Gummibärchen und Schokoladen-Tafeln. Das Übliche.
Können Sie die Bedenken verstehen, die es Halloween gegenüber gibt? Es gibt ja immer die Angst, dass dadurch etwa das Martinsfest verschwindet.
Fitzek: Diese Angst habe ich nicht. Wenn Kinder feiern wollen, lassen sie nicht eine Feier für die andere aus – da wird einfach beides gemacht. Aber ich kann die Konsumkritik so ein bisschen verstehen. Das ist bei uns in Deutschland ja nicht aus einer Tradition heraus entwickelt worden, sondern tatsächlich als Konsumgedanke aus Amerika 'rübergebracht worden. Nun habe ich überhaupt nichts gegen Amerika – im Gegenteil. Aber dort ist es eher natürlich gewachsen, bei uns ein bisschen aufgesetzt. Daher kann ich diese Kritik sehr gut verstehen.
Nicht nur an Halloween schauen die Leute gerne Horrorfilme oder lesen Thriller. Warum gehen Menschen ins Kino, wenn sie wissen, dass sie sich für eineinhalb Stunden fürchten werden?
Fitzek: Weil Menschen sich fürchten müssen, sonst hätten sie evolutionär überhaupt nicht überleben können. Die Angst wie der Selbsterhaltungstrieb sind da ein ganz wesentlicher Teil. Wir können uns aber nicht die ganze Zeit in unserem Leben fürchten. Vor allem: Wir können uns nicht in ein Auto setzen und jeder Sekunde darüber nachdenken, wie hoch die statistische Wahrscheinlichkeit ist, auf dieser Landstraße jetzt ums Leben zu kommen. Wir müssen wahnsinnig viel verdrängen – permanent.
Irgendwann können wir nicht mehr verdrängen und dann stellen wir uns diesen Ängsten sehr gerne. Dann aber möglichst fiktiven Ängsten, die wir auch noch beherrschen können. Dazu zählt Halloween mit dem Verkleiden ebenso wie das Lesen eines Thrillers. Das macht die Mehrheit nicht, weil sie extrem blutrünstig ist, sondern weil das eine Art Ventil ist, mit dem man sich den ganzen verdrängten Ängsten mal stellen kann.
Zuletzt gab es verschiedene Stimmen, die behaupteten, dass Thriller und Horrorliteratur boomen. Sehen Sie das auch so?
Fitzek: Diese Frage wird mir gestellt, seitdem ich schreibe. Es gibt diesen Boom offensichtlich schon seit acht Jahren – und ich glaube, es gab ihn schon davor. Das hängt eng mit der Frage zusammen, die Sie davor gestellt haben. Menschen haben eben ein Bedürfnis, sich zu gruseln. Deswegen setzen sie sich in die Achterbahn, weil sie da quasi ihr Nahtoderlebnis haben, in der Regel aber wieder lebendig rauskommen. Das hängt andererseits aber auch mit der Faszination des Themas Tod an und für sich zusammen. Es gibt wirklich wenige Themen auf der Welt, die uns alle unisono betreffen. Der Tod ist eines der vorherrschenden davon.
Der Tod ist aber auch etwas, das in unserer modernen Gesellschaft verdrängt wird. Während wir uns dem Thema früher in der Großfamilie häufiger gestellt haben und am eigenen Leibe miterlebt haben, wenn die Oma gestorben ist, findet das jetzt hinter verschlossenen Türen statt – meistens in Krankenhäusern, in Altersheimen. Wer von uns hat jetzt schon mal mit eigenen Augen eine Leiche gesehen? Ich glaube, dass das so eine Diskrepanz ist. Einerseits wollen wir das verdrängen, auf der anderen Seite müssen wir uns dem stellen. Je mehr das aus dem normalen Leben verbannt wird, desto mehr suchen wir es dann im Fiktiven. Das ist zumindest mein Erklärungsansatz.
Haben Sie denn schon einmal eine Leiche gesehen?
Fitzek: Ja, ich habe sogar mehrere Leichen an einem Tag sehen dürfen, als ich das Buch „Abgeschnitten“ mit Michael Tsokos geschrieben habe, dem Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité. Er hat mich an verschiedenen Obduktionen teilnehmen lassen, nicht aktiv, aber als passiver Beobachter. Das war aus mehreren Gründen eine Erfahrung. Der Anblick der Leichen war nicht das Schlimme, weil der Körper dann wirklich aussieht wie eine Puppe. Dieser Körper ist im wahrsten Sinne des Wortes entseelt. Man hat nicht das Gefühl, selbst wenn er geöffnet wird, dass man dabei zuschaut, wie einem Menschen was entnommen wird. Das wirklich Anstrengende und kaum zu Ertragende war der Geruch für mich.
Können Sie den Geruch beschreiben?
Fitzek: Ich habe es probiert in „Abgeschnitten“. Es ist ein Geruch aus zwei Komponenten, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite ist er süß, dieser Fäulnisduft, wie wenn eine Frucht verfault. Aber eben auch zersetzt mit dem Geruch nach ranzigem Fett oder ranziger Leberwurst. Eine süße, ranzige Leberwurst. Und dann wird natürlich von außen noch was hinzugefügt. Es wird versucht, den Geruch zu übertünchen. Wie auf einem Autobahnklo ist da noch das Desinfektionsmittel. Das ist ein ganz unheilvolles Gemisch, dass Sie auch lange nicht aus der Nase bekommen, weil es sich in Ihren Haaren und Ihrem Körper festsetzt, so dass Sie eigentlich duschen müssen, nachdem Sie die Obduktion miterlebt haben.
Bei welchem Buch haben Sie sich selbst zuletzt gefürchtet?
Fitzek: (Überlegt.) Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei einem Buch so richtig fürchte, das passiert selten. Wenn dieser Prozess einsetzt, springt leider mein analytisches Hirn ein und sagt: Wow, Faszination. Wie hat die Autorin, der Autor das geschafft? Dann ist der Grusel nicht mehr so da.
Aber dass ich ein schönes schauriges Gefühl bekomme, da gibt es zwei Bücher, die ich sagen nennen: Von Tom Callaghan „Blutiger Winter“ (erscheint im Januar 2015, d. Red.), das ist von einem Debütautoren, einem Australier. Ein erschreckend realistisch gezeichneter Thriller im Stil von „Kind 44“. Was schon auf dem Markt ist: „Das Seelenhaus“ von Hannah Kent. Das war jetzt weniger gruselig als wirklich schockierend, weil man gemerkt hat, dem Ganzen liegt ein wahrer Fall zugrunde. Und obwohl dieser Fall schon 1825 in Island spielt und sich mit einer Frau beschäftigt, die kurz vor der Hinrichtung steht, ist dieses Gesellschaftsleben, aber auch das Seelenleben dieser zum Tode Verdammten so toll gezeichnet, dass man das Buch mehrfach weglegen muss.
Und eine Sache kann ich noch sagen, ein Buch, das ich weggelegt habe, obwohl es wirklich sehr gut ist – das ist von Jack Ketchum „Evil“. Auf dem Klappentext steht drauf, dass es um Grausamkeiten geht, die Kindern in einer Kleinstadt zugefügt werden.
Und die ersten achtzig Seiten passiert nichts. Das ist so unerträglich, weil man weiß, es muss ja irgendwann losgehen. Als es dann wirklich losging, konnte ich nicht weiterlesen. Da habe ich mir überlegt, warum denn eigentlich nicht. Und ich habe recherchiert und festgestellt: Dem liegt ein wahrer Fall zugrunde. Ein wahres Verbrechen, diese unvorstellbaren Taten – und das hat man beim Lesen gespürt. Das ist mehr als bloße Unterhaltung. Und da muss ich sagen: Ich will mich nicht an realem Leid unterhalten.
Das Buch ist wirklich gut geschrieben, man spürt es, Stephen King hat es als Meisterwerk betitelt. Mir war es aber eben gerade wegen dieses wahren Kerns zu hart. Der wahre Fall ist im Übrigen noch härter als das, was dort beschrieben wird. Wie so oft ist die Realität grausamer als das, was sich ein Autor ausdenken kann.
Gibt es für Sie als Autoren denn Grenzen beim Schreiben?
Fitzek: Nein, die gibt es nicht. Aber es gibt eine Grenze, die abstrakt definiert werden kann: Wenn die explizite Gewaltdarstellung ausschließlich dazu dient, irgendeinen Blutzoll zu befriedigen. Es heißt oftmals, dass ich sehr hart schreibe, das stimmt aber gar nicht – auch im Vergleich zu anderen Autoren oder etwa zu Jack Ketchum zum Beispiel. Ich bin für explizite Gewaltdarstellungen eigentlich überhaupt nicht berühmt. Meine Titel sind vielleicht manchmal martialisch. Wie beim „Augensammler“, da wird der Vorgang des Augensammelns aber mit keinem einzigen Wort beschrieben.
Dann gibt es Bücher wie „Abgeschnitten“, die sind tatsächlich zwar gewalttätig, aber dort ergibt die Gewalt zumindest aus meiner Perspektive einen übergeordneten Sinn und es ist durch das Thema des Buchs vorgegeben. Es geht in dem Buch um die höhere Bestrafung von Vermögensdelikten im Vergleich zu Delikten gegen die körperliche Unversehrtheit. Und wenn ich das klarmachen will, dass jemand für eine Steuerhinterziehung 15 Jahre in den Knast kommt, jemand aber, der seine Tochter 125-mal vergewaltigt hat, eventuell auf Bewährung freikommt, muss man diese beiden Fälle auch spürbar gegenüberstellen.
So ergibt dann die Gewaltdarstellung einen Sinn, um etwas zu belegen beispielsweise. Das kann ich hoffentlich bei fast allen meinen Büchern deutlich machen.
Insofern ist diese Grenze tatsächlich dort gegeben. Die Grenze zwischen Gewalt und Splatter ist oftmals fein zu ziehen – Splatter ist aber nicht mein Ding.
Für welchen Satz eines Autoren würden Sie töten, um ihn unbemerkt in einem Ihrer Bücher unterzubringen?
Fitzek: (Lacht.) Ich würde nicht so weit gehen zu töten, aber ich finde bei Tom Wolfe immer wieder tolle Formulierungen. Er hat beispielsweise eine Frau wie ein Meisterwerk von Monet beschrieben. Also, von weitem bildschön und je näher man rankommt, desto unschöner wird das Bild.
Das ist bei Wolfe natürlich viel besser formuliert. Von derartigen Vergleichen finden sich aber sehr viele Sätze bei ihm, bei denen man sich denkt: Ach, verdammt! Da wäre man gerne selber draufgekommen.
Sebastian Fitzeks neuer Roman "Passagier 23" erscheint am 30. Oktober. Der Berliner Autor kommt am 12. November in die Thalia-Filiale am Hugenottenplatz in Erlangen, um dort aus seinem Thriller vorzulesen.
Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.
0/1000 Zeichen